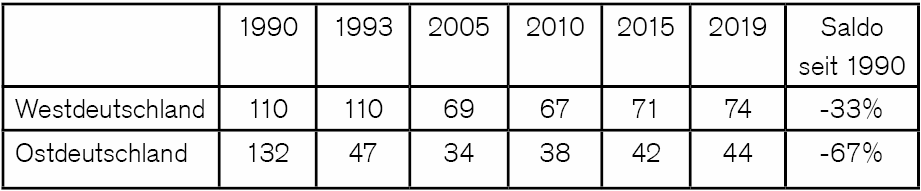Ökonomie und Machtverhältnisse in Ostdeutschland
Die Besetzung der Führungspositionen in Ostdeutschland gibt der Metapher der „Neuen Länder“ als Bezeichnung von Ostdeutschland einen Sinn. Obwohl sie für diejenigen, die schon immer hier leben, gar nicht neu sind, wurden die Neuen Länder im kolonialen Geist der Eroberung vom Westen „entdeckt“ und unter die Kontrolle der eigenen Eliten gestellt.
Von Andrej Holm
Aus telegraph #137/138 2020/2021 (telegraph bestellen?)
Vor 20 Jahren wurde die Frage nach den sozialen und ökonomischen Verhältnissen in Ostdeutschland im telegraph als koloniale Struktur beschrieben. Ausgangspunkt der Analyse war die Annahme einer politischen, ökonomischen und kulturellen Dominanz des Westens, die in der Konsequenz eine Bereicherung des Mutterlandes bewirkt und zur Verarmung des kolonisierten Territoriums beiträgt. Die damals vorgetragenen Argumente bezogen sich auf die Zerschlagung der industriellen Basis der ostdeutschen Wirtschaft, die Umverteilungsprozesse von Immobilien und Produktionsanlagen zugunsten von Westdeutschen und die Besetzung von Führungspositionen in Verwaltung und Wirtschaft durch Westdeutsche.
An den empirischen Befunden hat sich seitdem wenig geändert. Ostdeutschland ist eine weitgehend deindustrialisierte Region, die Eigentumsverhältnisse im Bereich der Grundstücke und Häuser bleiben entregionalisiert und die Elitenreproduktion in Führungspositionen ist nach wie vor westdeutsch dominiert.
Wirtschaftliche Sonderzone Ost: kleingehalten und in dauerhafter
Abhängigkeit
Die wirtschaftlichen Strukturdaten weisen Ostdeutschland als eine weitgehend deindustrialisierte Region aus. Die Abwicklung der ostdeutschen Wirtschaft durch die Treuhand hat sich als äußerst nachhaltig erwiesen.
Entwicklung der Beschäftigten in der Industrie je 1.000 Einwohner*innen
Im Vergleich zum Industrialisierungsgrad von 1990 ist der Anteil von Industriebeschäftigten in Westdeutschland um etwa ein Drittel zurückgegangen, in Ostdeutschland sogar um zwei Drittel. In vielen wirtschaftlichen Studien wird die Deindustrialisierung als allgemeiner Strukturwandel beschrieben, der mehr oder weniger alle früheren Industrieländer in den letzten 30 Jahren erfasst hat. Die Situation in Ostdeutschland muss jedoch als Strukturbruch beschrieben werden, der die industrielle Basis der regionalen Wirtschaft weitgehend aufgelöst hat. Mit Blick auf den Zeitverlauf wird zudem deutlich, dass dieser Strukturbruch mit einer Schocktherapie zu Beginn der 1990er Jahre erfolgte. Die Treuhandpolitik hatte in nur drei Jahren einen deutlich tieferen Einschnitt (-65 Prozent) in die industrielle Basis geschlagen als 30 Jahre Strukturwandel in Westdeutschland (-33 Prozent). Allein zwischen 1990 und 1993 wurden in Ostdeutschland fast 1,5 Mio. Industriearbeitsplätze abgewickelt.
Seit 2005 steigt in beiden Landesteilen die Zahl der Industriebeschäftigten wieder leicht an. In Ostdeutschland stieg die Zahl der Industriebeschäftigten bis zum Jahr 2019 um etwa 175.000. In Westdeutschland betrug der Anstieg neuer Industriearbeitsplätze im selben Zeitraum über 315.000. Das waren in beiden Teilen etwa 11 Prozent der Verluste, die es bis zum Jahr 2005 gegeben hatte.
Auch ein Vergleich der Entwicklung der regionalen Wirtschaftsleistung zeigt, dass Ostdeutschland den Abstand zu Westdeutschland in den 30 Jahren seit dem Anschluss an die Bundesrepublik nicht schließen konnte. Der Abstand des Bruttoinlandproduktes pro Kopf hat sich zwischen 1991 und 2019 kaum verändert und hat sich lediglich von 12.800 Euro (1991) auf 10.700 Euro (2019) verringert.
Ein Blick auf die Entwicklung in anderen Ländern Osteuropas zeigt, dass die Entwicklung in Ostdeutschland zu den Wirtschaftsdaten von Tschechien, der Slowakei, Polen oder Ungarn einen ähnlichen Abstand hat, wie zu denen von Westdeutschland. Vergleichsdaten des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen: Gemessen an den Kennzahlen für das Bruttoinlandprodukt (BIP) je Kopf ist in den anderen osteuropäischen Ländern ab den 2000er Jahren ein deutlicher Aufholprozess zu beobachten. Zwischen den Jahren 2000 und 2019 stieg das jährliche BIP pro Kopf In Tschechien (+20.300 €), der Slowakei (+18.600 €) und Ungarn (+ 15.200 €) sogar in absoluten Zahlen stärker als in Ostdeutschland (+14.300) €). Die insgesamt höhere Wirtschaftsleistung in Ostdeutschland lässt sich eher aus den besseren Startbedingungen als aus den Entwicklungsdynamiken der letzten zwei Dekaden erklären.
Ostdeutschland hatte gegenüber den anderen sozialistischen Ökonomien 1990 einen deutlichen Vorsprung, weist aber in den letzten 30 Jahren eine deutlich geringere Entwicklungsdynamik auf. Selbst in Rumänien (+738 Prozent) hat sich das Bruttoinlandsprodukt deutlicher entwickelt als in Ostdeutschland (+248 Prozent). Vor allem in den Jahren ab der Jahrtausendwende erlebten die Länder Osteuropas nach dem EU-Beitritt einen regelrechten Schub in ihrer Wirtschaftsentwicklung, der in Ostdeutschland weitgehend ausblieb.
Der sich verfestigende Abstand zur westdeutschen Wirtschaft wird in Studien von Wirtschaftsinstituten auf die Struktur der ostdeutschen Wirtschaft zurückgeführt. Die Zerschlagung der Kombinate durch die Treuhand hatte zur Folge, dass die Wirtschaft in Ostdeutschland bis heute von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist. Nach Angaben des von der Zeitung Die Welt jährlich erstellten Top 500 Ranking der größten Unternehmen in Deutschland liegen nur 16 davon im Osten des Landes – das entspricht gerade einmal drei Prozent. Nur fünf dieser großen Unternehmen werden von ostdeutschen Führungskräften geleitet. In vielen Bereichen hat sich Ostdeutschland vor allem zu einer verlängerten Werkbank entwickelt – wichtige Entscheidungen werden nach wie vor im Westen getroffen.
Die Funktion einer nachgeordneten Fertigung wird auch in den Exportanteilen der Industrieproduktion deutlich. Während in westdeutschen Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 50 Prozent des Umsatzes im Ausland erzielt wird, liegt der Anteil des Auslandsumsatzes der Betriebe in Ostdeutschland bei gerade mal 36 Prozent. Noch deutlicher wird die Binnenorientierung der ostdeutschen Wirtschaft mit Blick auf die Auslandsinvestitionen. Nach Zahlen der Deutschen Bundesbank sind unter den 1.277 Mrd. Euro, die deutsche Unternehmen im Ausland investieren, gerade einmal 13 Mrd. Euro von Firmen, die ihren Sitz in Ostdeutschland haben – das sind nur knapp über 1 Prozent der globalisierten Investitionen, die bundesweit registriert wurden.
Das blumige Versprechen von den blühenden Landschaften hat sich ebenso wenig realisiert wie die regelmäßigen Wasserstandsmeldungen vom Aufholprozess. Eine Studie am Institut für Geographie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena untersuchte die Entwicklungspotentiale für ostdeutsche Landkreise und kreisfreie Städte in Ostdeutschland. Von insgesamt 76 untersuchten Regionen wurden nur für sechs Städte (Dresden, Erfurt, Jena, Leipzig, Potsdam und Schwerin) Entwicklungspotentiale für eine wirtschaftliche Prosperität gesehen. In weiteren 16 Landkreisen wird ein mittleres Entwicklungspotential vermutet und für die restlichen 54 Regionen in Ostdeutschland werden Szenarien der fortgesetzten Schrumpfung, überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit und hoher Entwicklungsrisiken prognostiziert. Fast 70 Prozent der Bevölkerung in Ostdeutschland lebt 30 Jahre nach der Umsetzung des Einigungsvertrages in Regionen, die wohl keine Chance haben werden, jemals auch nur das westdeutsche Durchschnittniveau an Wirtschaftsleistung und Wohlstand zu erreichen. Die Studie verweist mit ihren Analysen auf einen sehr stark ausgeprägten Stadt-Land-Gegensatz. Während die Leuchttürme des möglichen Aufschwungs fast ausschließlich in den ehemaligen Bezirksstädten liegen, ist die Vielzahl der abgehängten Regionen überwiegend ländlich geprägt.
Dominik Intelmann, Humangeograph aus Leipzig, kommt in seinen Überlegungen zur Politischen Ökonomie Ostdeutschlands zu dem Ergebnis einer „strukturellen Abhängigkeit vom westdeutschen Landesteil“, das durch das „Fehlen einer lokalen Eigentümerklasse“ und „dauerhaften Transferabhängigkeit“ geprägt sei. Dabei habe die Privatisierungspolitik der Treuhand zu Gunsten von westdeutschen Unternehmen eine dauerhafte Struktur herausgebildet. Auch Jahrzehnte nach der Zerschlagung der Wirtschaft im Osten gehören nur 25 Prozent des volkswirtschaftlichen Kapitalstocks ostdeutschen Unternehmen. Die Zerschlagung und Privatisierung der großen Unternehmen und Kombinate führt dazu, dass ostdeutsche Unternehmen meist Neugründungen mit geringer Kapitalausstattung und begrenzten Wachstumsmöglichkeiten sind. Auf der anderen Seite – so der Wirtschaftsprofessor Udo Ludwig – stehen die wenigen größeren Betriebseinheiten in Ostdeutschland als „fremdbestimmte großbetriebliche Werkbänke“ unter westdeutscher Unternehmensführung. Ein Großteil der Arbeitsplätze in Ostdeutschland hängt bis heute von „Filialbetrieben gebietsfremder Unternehmen“ ab.
Diese Situation führt dazu, dass die wirtschaftliche Leistungsbilanz von Ostdeutschland eine dauerhafte Produktionslücke aufweist und der regionale Verbrauch nicht von den in Ostdeutschland produzierten Waren gedeckt werden kann. Die umfangreichen Transferleistungen für Ostdeutschland sichern seit Anfang der 1990er Jahre so vor allem den Absatz westdeutscher Unternehmen. Auch nach der Jahrtausendwende glichen die jährlichen Transferzahlungen in Höhe von etwa 70 Mrd. Euro vor allem die Produktionslücke von 50 Mrd. Euro aus und fanden so zu einem großen Teil über den Kauf von Konsumgütern den Weg zurück in den Westen. Hinzu kommen bis zu 20 Mrd. Euro pro Jahr, die an Mieten, Pachten und Anlageerlösen nach Westdeutschland abfließen. Auch Karl Mai von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik geht davon aus, dass Transferleistungen in einem großen Umfang als Erlöse aus dem Verkauf von Warenlieferungen letztendlich in den Westen zurückfließen. Die Infrastrukturen für diesen Kapitaltransfer von Ost nach West wurden mit der Aufteilung Ostdeutschlands durch westdeutsche Handelsketten wie Kaufland, Möbel Höffner und eine Reihe von Lebensmittel-Discountern sichergestellt.
Unabhängig davon, ob die Situation auf die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Industrie, die Schwierigkeiten beim Aufbau neuer Unternehmen oder die Dominanz von eher kleineren Betrieben zurückgeführt wird – in Ostdeutschland wurde in den letzten 30 Jahren eine vom Westen abhängige Wirtschaftsstruktur etabliert, deren Entwicklung im Wesentlichen von westdeutschen Interessen bestimmt wird und dauerhaft in eine Transferökonomie eingebunden ist, die einen kontinuierlichen Abfluss von Zahlungen nach Westdeutschland ermöglichen.
Verwestlichung der Eigentümerstruktur
Als zweiter Kolonialisierungsbefund in den Diskussionen Ende der 1990er Jahre wurde die Privatisierung von Wohnungsbeständen und Immobilien zugunsten westdeutscher Eigentümer*innen angeführt. Ein Blick auf die aktuellen Verhältnisse zeigt, dass auch damit eine dauerhafte Ungleichheitsstruktur etabliert wurde.
Durch Restitution, Altschuldenhilferegelung und die Privatisierung von Betriebswohnungen durch die Treuhand gingen in den 1990er Jahren etwa 1,2 Millionen Wohnungen in Ostdeutschland überwiegend in westdeutsches und internationales Eigentum über. In den 2000er Jahren wurde dieser Trend durch die Privatisierung von öffentlichen Wohnungsunternehmen noch verstärkt, so dass heute mit etwa 2,5 Millionen Wohnungen fast ein Drittel aller Wohnungen von Eigentümerinnen und Eigentümern bewirtschaftet wird, die nicht selbst in Ostdeutschland leben. Bezogen auf den Mietwohnungsbestand entspricht das einem Anteil von über 40 Prozent.
Im Unterschied zu den Strukturen des Wohnungswesens in Westdeutschland weist der Osten einige Besonderheiten auf. Der Anteil von Wohnungen in selbstgenutztem Eigentum und Eigenheimen liegt mit 31 Prozent unter dem westdeutschen Vergleichswert von 45 Prozent. Mit über 2 Millionen Wohnungen liegt der Anteil von institutionellen Unternehmen und Fonds mit 26 Prozent deutlich über dem Anteil dieser Unternehmen in Westdeutschland (12 Prozent). Trotz der massiven Privatisierungen seit 1990 liegt der Anteil der genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungen mit zusammen 27 Prozent fast dreimal so hoch wie in Westdeutschland (10 Prozent). Dafür ist der Anteil an privat vermieteten Wohnungen mit lediglich 16 Prozent nur halb so groß wie in Westdeutschland (33 Prozent).
In der alten Bundesrepublik wird das Geschäft der Privatvermietung von lokalen und regionalen Eigentumsbezügen geprägt. In Ostdeutschland sind knapp 28 Prozent der privatvermieteten Wohnungen im Eigentum von Westdeutschen. Umgekehrt werden in Westdeutschland nur 1,9 Prozent der Wohnungen von Ostdeutschen vermietet. Zusammen mit den institutionellen Anbietern (von denen nur ein kleiner Anteil in ostdeutschem Besitz ist) fließen damit etwa 40 Prozent der ostdeutschen Mieterträge nach Westdeutschland oder ins Ausland. Bei durchschnittlichen Bestandsmieten von etwa 6 €/m² (nettokalt) im Monat entspricht das – nach Abzug der Bewirtschaftungskosten – einem jährlichen Mittelabfluss aus Ostdeutschland von etwa 10 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs erhielten die ostdeutschen Bundesländer (inklusive Berlin) im Jahr 2019 knapp 7,9 Mrd. Euro.
Die ungleichen Eigentumsverhältnisse spiegeln sich auch in der Verteilung der Haushalte wider, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Von den insgesamt 3,6 Millionen Privatvermieter*innen haben gerade einmal 390.000 ihren Wohnsitz in Ostdeutschland. Obwohl dort fast 70 Prozent der Haushalte zur Miete wohnen, beträgt der Anteil der Haushalte, die Einkünfte aus der Vermietung haben, gerade einmal 4,9 Prozent. In Westdeutschland fällt der Mietwohnanteil (55 Prozent) kleiner und der Anteil von Vermieter*innen (10 Prozent) deutlich größer aus.
Die Schieflage der Eigentümerstrukturen in Ostdeutschland wurde in seiner Grundstruktur durch die vereinigungsbedingten Gesetze der Restitution und Altschuldenhilferegelung geschaffen und durch spätere Privatisierungen öffentlicher Wohnungsbestände und Abrissprogramme zu Lasten der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen verstärkt. Die Kennzahlen für die „Abgänge“ von Wohnungen sind der einzige wohnungswirtschaftliche Indikator, in dem Ostdeutschland mit 460.000 Abrissen „besser“ abschneidet als Westdeutschland mit 420.000 Abrissen. Bezogen auf die Bevölkerungsanteile wird der Unterschied noch deutlicher: Während zwischen 1990 und 2019 im Westen rechnerisch 6 Wohnungen je 1.000 Einwohner*innen abgerissen wurden, lag der Vergleichswert für Ostdeutschland bei 27 abgerissenen Wohnungen.
Das staatlich finanzierte Programm „Stadtumbau Ost“ setzte als Reaktion auf die schrumpfenden Bevölkerungszahlen in vielen Städten auf einen umfangreichen Rückbau der Wohnsiedlungen, die im Rahmen des DDR-Wohnungsbauprogramms entstanden waren und überwiegend von ostdeutschen Wohnungsunternehmen verwaltet wurden. In die Altbaubestände hingegen, die nach der Restitution zu einem großen Anteil an westdeutsche Eigentümer*innen verkauft wurden, flossen öffentliche Fördermittel und umfangreiche Steuererleichterungen in die umfassende Sanierung und Aufwertung der Bestände. Insbesondere die größeren Städte in Ostdeutschland sind durch zunehmend polarisierte Stadtstrukturen geprägt, bei denen die ärmeren Haushalte in den oft von ostdeutschen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften verwalteten Wohngebieten an den Rändern der Städte leben und sich die Besserverdienende in den sanierten Altbauvierteln konzentrieren, die zu einem großen Teil von westdeutschen Eigentümern vermietet werden und auch künftig steigende Erträge ermöglichen.
Eine vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung herausgegebene Untersuchung zu privaten Kleinvermieter*innen in Ost- und Westdeutschland verweist auf den deutlichen Ost-West-Unterschied in den Vergleichsstädten. Während in den untersuchten westdeutschen Städten mit über 60 Prozent der größte Teil der privaten Kleinvermieter*innen den eigenen Wohnsitz in derselben Stadt hat, stellt sich diese Situation in ostdeutschen Großstädten anders dar. Exemplarisch wird die Situation von Dresden beschrieben: Nur 29 Prozent der Vermieter*innen in der sächsischen Metropole leben in Dresden, weitere 11 Prozent haben ihren Wohnsitz in anderen ostdeutschen Orten – die große Mehrheit kommt mit 61 Prozent aus Westdeutschland.
Die mit dem Wiedervereinigungsprozess durchgesetzte Neuordnung der Eigentumsverhältnisse hat nicht nur zu einer umfassenden Privatisierung der Mietwohnungsbestände geführt, sondern darüber hinaus eine Struktur etabliert, in der ostdeutsche Wohnverhältnisse dauerhaft von westdeutschem Eigentum geprägt werden und einen kontinuierlichen Ost-West-Vermögenstransfer ermöglichen.
Westdeutsche Elitendominanz
Auch die dritte Ebene der Kolonialisierungsthese hat sich seit Ende der 1990er Jahre kaum verändert. Noch immer ist die Besetzung von Entscheidungspositionen in Ostdeutschland von Westdeutschen geprägt. Der Leipziger Regisseur und Filmproduzent Olaf Jacobs hat in den letzten Jahren dutzende Dokumentationen zur Situation in Ostdeutschland veröffentlicht. Eine Begleitstudie zur Doku-Serie „Wer beherrscht den Osten?“ belegt die fortbestehende Unterrepräsentation von Ostdeutschen ausführlich und kommt im Jahr 2016 zu dem Schluss: “Ein Nachrücken Ostdeutscher in Führungspositionen in Ostdeutschland entsprechend der Bevölkerungsverteilung ist kaum feststellbar“. Nur 23 Prozent der Führungspositionen in Ostdeutschland werden von ostdeutschen Führungskräften besetzt. Bundesweit sind es sogar nur 1,7 Prozent – gemessen am Bevölkerungsanteil von 17 Prozent eine erhebliche Repräsentationslücke. Die Vertretungslücke ist dabei übergreifend in fast allen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachten. So kommen nur drei der über 50 Staatssekretäre der Bundesministerien aus dem Osten. Ebenfalls nur drei Führungskräfte der insgesamt 190 Vorstände der DAX-Unternehmen sind Ostdeutsche. Nicht viel besser sieht es bei der Bundeswehr aus: nur zwei der insgesamt 200 Generäle und Admirale haben eine ostdeutsche Herkunft.
Die Dominanz von westdeutschen Eliten ist dabei nicht nur auf der Bundesebene festzustellen, sondern prägt auch die Situation in den ostdeutschen Bundesländern in den Bereichen Politik, Justiz, Medien und Wirtschaft. Auch wenn ein Großteil der Ministerpräsident*innen im Osten von Ostdeutschen gestellt wird, bleibt die Verwaltungselite fest in westdeutscher Hand: Mehr als die Hälfte der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre kommt aus dem Westen.
Ganz ähnlich sieht es im Bereich der Justiz aus. Von den über 600 Richterstellen an den obersten Gerichten der neuen Bundesländer werden gerade einmal 13 Prozent von ostdeutschen Richterinnen und Richtern besetzt. Bei den Präsidenten und Vizepräsidenten der Gerichte sowie den Vorsitzenden Richter*innen der einzelnen Senate liegt der Ostanteil sogar nur bei weniger als 6 Prozent.
Ebenfalls gering fällt der Anteil von Ostdeutschen im Bereich der Medien in Ostdeutschland aus. So werden die Leitungspositionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (MDR, NDR, RBB) nur zu 27 Prozent von Ostdeutschen besetzt. Bei den Verlagen der größten Regionalzeitungen in Ostdeutschland liegt der Anteil der Geschäftsführer und Verlagsleiter sogar nur bei 9 Prozent.
Auch die Wirtschaftsunternehmen in Ostdeutschland werden überwiegend von Westdeutschen geleitet. Von den 100 größten Unternehmen in Ostdeutschland werden nur 25 Prozent von Ostdeutschen geführt. Der Anteil der Stellvertretenden der Unternehmensleitung liegt immerhin bei 45 Prozent. Mit Blick auf die ökonomischen Führungspositionen hat sich Ostdeutschland zum Land der Stellvertreter entwickelt.
Auch unter den Direktoren, Vorständen und Institutsleiter*innen der großen Forschungsinstitute in den neuen Bundesländern sind ostdeutsche Wissenschaftler*innen mit gerade einmal 15 Prozent auch Jahrzehnte nach der Einheit die Ausnahmen.
Die Besetzung der Führungspositionen in Ostdeutschland gibt der Metapher der „Neuen Länder“ als Bezeichnung von Ostdeutschland einen Sinn. Obwohl sie für diejenigen, die schon immer hier leben, gar nicht neu sind, wurden die Neuen Länder im kolonialen Geist der Eroberung vom Westen „entdeckt“ und unter die Kontrolle der eigenen Eliten gestellt.
Die deutliche Unausgeglichenheit in der Besetzung von Führungspositionen wird in öffentlichen Debatten überwiegend auf einen „biografischen Modernisierungsrückstand“ oder die mit der politische Wende einhergehende Absetzung der früheren SED-Kader zurückgeführt. Der Mangel an ostdeutschen Führungskräften wird dabei auf die Nähe zum alten Regime oder den Rückstand von Ostdeutschen auf bundesdeutschen Karriereleitern und Netzwerken zurückgeführt.
Solch ein individualisierender Blick auf die Defizite der Ostdeutschen versperrt jedoch die Analyse der ökonomischen Interessen und strukturellen Muster einer westdeutschen Dominanz in den Führungspositionen Ostdeutschlands. Der Soziologe Raj Kollmorgen interpretiert die wiederkehrende Reproduktion der ostdeutschen Repräsentationslücke als „statuspositionale Missachtung durch Exklusion“ und zeigt in seinen Studien, wie die Rekrutierungsstrategien der westdeutschen Eliten den dauerhaften Ausschluss von Ostdeutschen aus Führungspositionen im „Interesse an Machterhalt und Machtexpansion“ immer wieder aufs Neue sicherstellen.
Kollmorgen verbindet die einseitige Besetzung der Führungspositionen in Ostdeutschland mit den durch den Vereinigungsprozess geschaffenen ökonomischen Strukturen und unterstellt eine politische Intention der Westdominanz im Osten: „Die Eliten kalkulierten einen Vereinigungsmehrwert, der für die westdeutsche Volkswirtschaft und für sie selbst die politischen und ökonomischen Kosten deutlich übersteigen sollten“.
Die weitgehende Abwesenheit von ostdeutschen Führungskräften in Politik, Wirtschaft und Medien wird von vielen Ostdeutschen als Sinnbild einer allgemeinen Benachteiligung im Ost-West-Verhältnis verstanden. Im „Jahresbericht der Bunderegierung zum Stand der Deutschen Einheit“ von 2019 wird auf eine von der Bunderegierung durchgeführte Umfrage zu Einstellungen in Ostdeutschland Bezug genommen. Demnach „fühlen sich (…) 57 Prozent der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse. Die Wiedervereinigung halten nur rund 38 Prozent der Befragten im Osten für gelungen. Bei Menschen unter 40 sind es sogar nur rund 20 Prozent“.
Verglichen mit früheren Umfragen hat sich die Einschätzung zum Stand der Einheit damit in den letzten Jahren wieder verschlechtert. Die Frage, ob sie sich als „Bürger zweiter Klasse fühlen“, bejahten 1990 noch 92 Prozent der Ostdeutschen. Gut 10 Jahre nach der Vereinigung lag der Anteil noch bei 74 Prozent (2001) und sank bis 2009 auf 42 Prozent. In den letzten 10 Jahren stieg der Wert der Ostdeutschen, die sich gegenüber den Westdeutschen als „Bürger zweiter Klasse“ sehen, wieder an. Die negativen Einschätzungen zum „Gelingen der Wiedervereinigung“ verweisen auf eine dauerhafte Präsenz der mit dem Vereinigungsprozess verbundenen Probleme und Benachteiligungen. Der Berliner Soziologie Steffen Mau bezeichnet diese dauerhaften Benachteiligungserfahrungen als „gesellschaftliche Frakturen“. Dass insbesondere die jüngere Generation der heute unter 40 Jährigen den Vereinigungsprozess noch negativer einschätzt, zeigt, dass die Wahrnehmung einer sozialen Deklassierung in Ostdeutschland nicht nur aus biographischen Erfahrungen abgeleitet wird, sondern die gesellschaftliche Stimmung und die langfristig etablierten Strukturen und Verhältnisse in Ostdeutschland reflektiert.
Kolonie, Peripherie, abhängige Sonderzone?
Die Situation in Ostdeutschland ist auch 30 Jahre nach dem Vereinigungsprozess wesentlich vom Ost-West-Verhältnis in der Bundesrepublik geprägt. Der wirtschaftliche Entwicklungsrückstand einer dauerhaft transferabhängigen Sonderzone, die Etablierung westdeutschen Grund- und Immobilienbesitzes und die anhaltende Repräsentationslücke von Ostdeutschen in gesellschaftlichen Schlüsselpositionen prägen das Bild einer abhängigen Region ohne eigene politische und wirtschaftliche Macht.
Der Historiker Jochen Osterhammel definiert Kolonie als „ein durch Eroberung (…) neugeschaffenes politisches Gebilde, dessen landfremde Herrschaftsträger in dauerhaften Abhängigkeitsbeziehungen zu einem räumlich entfernten ‚Mutterland‘ stehen, welches exklusive ‚Besitz‘-Ansprüche auf die Kolonie erhebt“. Um vollständig dem geschichtswissenschaftlichen Kolonial-Begriff zu entsprechen, fehlt der Situation in Ostdeutschland vor allem der Aspekt des „räumlich entfernten Mutterlandes“. Im Rückblick auf die Politik der Treuhand, die Reprivatisierung von Landwirtschafsflächen, Wäldern und Häusern sowie die Inkorporationslogik des Institutionentransfers nach 1990 liegt die Qualifizierung des Vereinigungsprozesses als „Eroberung“ im Auge der Betrachtenden.
Steffen Mau, der in seinem Buch „Lütten Klein“ die schmerzhaften Brüche des Transformationsprozesses in Ostdeutschland anschaulich nachzeichnet, lehnt den Kolonialisierungsvorwurf als „irreführend und unlauter“ ab und schlägt vor, stattdessen von einer „Majorisierung des Ostens“ zu sprechen, weil die „zahlenmäßige Minderheit der Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland erleben musste, dass die bloße Anwendung des Mehrheitsprinzips für sie zur Fremdbestimmung wurde“. In einer solchen Perspektive auf die numerischen Verhältnisse zwischen Ost und West verschwinden jedoch die strukturellen Momente der Fremdbestimmung, die sich in den parakolonialen Eigentumsverhältnissen und Machtstrukturen in Ostdeutschland materialisieren.
Zudem gibt es für die Überwindung einer Majorisierung durch ungleiche Bevölkerungsanteile keine Perspektive. Eine Dekolonisierung hingegen würde auf der Basis von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung eine eigenständige soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung ermöglichen. Zu streiten wäre dann vor allem darüber, wie mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung Ostdeutschlands unter den Bedingungen eines vereinigten Deutschlands durchgesetzt und ausgestaltet werden kann.
Die identitätspolitischen Bezüge auf Ostdeutschland sind zurzeit eher diffus und reichen von Selbstverortungen ostdeutscher Fußballfans über von subjektiven Erfahrungen getragenen Diskursinterventionen wie bei Jana Hensel oder Valerie Schönian bis hin zu einer kritischen Wiederaneignung der Nachwendegeschichte durch die Initiative Aufbruch Ost. Die gemeinsamen Bezugspunkte sind relativ gering und bislang weitgehend ohne einen wirksamen Impuls für die Veränderung der ökonomischen und politischen Verhältnisse in Ostdeutschland. Eine Initiative für eine ostdeutsche Selbstbestimmung müsste aber genau dort ansetzen, wo die Verhältnisse der ökonomischen Abhängigkeit und politischen Marginalisierung den Alltag prägen. Die Forderung nach mehr Anerkennung für den Osten und die Ostdeutschen wird nicht ausreichen, weil strukturelle Bedingungen nur durch eine substantielle Umverteilung von Macht und Eigentum aufgebrochen werden können.
Zum Weiterlesen:
BBR (2007): Investitionsprozesse im Wohnungsbestand – unter besonderer Berücksichtigung privater Vermieter. In: Forschungen Heft 129. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Henn, Sebastian, Schäfer, Susann 2020: Wirtschaftsräumliche Struktur und Entwicklung Ostdeutschlands. Ein Überblick. In; Becker, Sören; Naumann, Matthias (Hrsg.): Regionalentwicklung in Ostdeutschland. Dynamiken, Perspektiven und der Beitrag der Humangeographie. Berlin: Springer, 85-98.
Hensel Jana; Engler, Wolfgang 2018: Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein. Berlin: Aufbau-Verlag
Intelmann, Dominik 2020: Kapitalmangel und Transferabhängigkeit. Zur Politischen Ökoniomie Ostdeutrschlands. In: Becker, Sören; Naumann, Matthias (Hrsg.): Regionalentwicklung in Ostdeutschland. Dynamiken, Perspektiven und der Beitrag der Humangeographie. Berlin: Springer, 99-110.
Jacobs, Olaf, Michael Bluhm 2016: Wer beherrscht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung. Leipzig: Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig
Kollmorgen, Raj 2011: Subalternisierung. Formen und Mechanismen der Missachtung Ostdeutscher nach der Vereinigung. In: Kollmorgen, Raj; Koch, Frank Thomas; Dienel, Hans-Liudger (Hrsg.): Diskurse der deutschen Einheit. Kritik und Alternativen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 301-359.
Ludwig, Udo 2017: Der Neuaufbau der Wirtschaft. In: Schneider, Jürgen (Hg.) Einigkeit, Recht und Freiheit: 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung (1990-2015). Stuttgart: Franz Steiner, 573-620.
Mai, Karl 2006: Ost-West-Transferleistungen heftig umstritten: Fakten contra Mythen. In: Busch, Ulrich; Mai, Karl; Steinitz, Klaus (Hrsg.): Ostdeutschland – Zwischen Währungsunion und Solidarpakt II. eine Retrospektive kritisch-alternativer Ökonomen. Berlin: trafo, 209-234.
Mau, Steffen 2019: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp
Schönian, Valerie 2020: Ostbewusstsein. Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet. München: Piper
Wingens, Matthias 1999: Der „gelernte DDR-Bürger“: biographischer Modernisierungsrückstand als Transformationsblockade? Planwirtschaftliche Semantik, Gesellschaftsstruktur und Biographie. In: Soziale Welt, 50/3, 255-280
Andrej Holm ist seit Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen Stadtteilgruppen und Mieterinitiativen aktiv und arbeitet als Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Aus telegraph #137/138 2020/2021 (telegraph bestellen?)