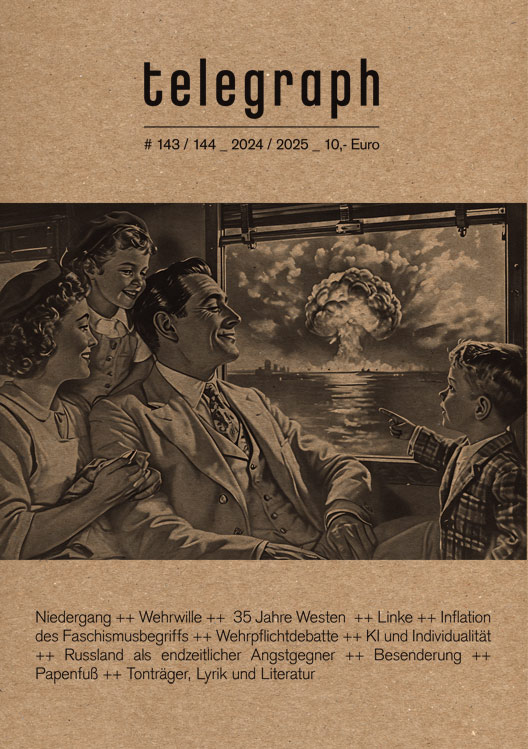Sie reden unaufhörlich vom „Ende des Kalten Krieges“, das 1989/91 erreicht worden sei, obwohl sie ihn mit Ausgrenzungen aller Art und Nato-Erweiterungen doch ständig fortsetzen. Die Formel verdeckt nur ihr Siegesgeschrei, sie wollen damit sagen, sie hätten jenen Krieg gewonnen und dürften nun nicht aufhören, weiterhin zu siegen.
Von Klaus Wolfram
Fangen wir doch mal von unten an, da, wo die neue Zeit auch wirklich begann und zu beginnen noch immer nicht aufgehört hat. In ganz Osteuropa handelte es sich 1989 um basisdemokratisch auftretende und handelnde Bewegungen, die dem alten Staatsaufbau die Legitimität entzogen, ihn erstaunlich schnell auflösten und selbst versuchten, sich an seine Stelle zu setzen. Vorgänge, von denen mehrere Generationen bis dahin und in ihren je verschiedenen politischen Farben nur hatten träumen können. Jedem war klar, dass es sich unumkehrbar um den Untergang des Stalinismus handelte, doch mehr auch nicht. Was der gewesen war, welche Gesellschaft man jetzt selbst war, wo der Weg weiter verlaufen könnte, das war im Dunkel des gelebten Augenblicks verborgen.
Dem eigenen Aufbruch folgte bald ein ebenso großer Umbruch. 1991 zerbrach die Sowjetunion unter dem Druck ihrer internen Spannungen. Die Demokratisierung war hier von oben angestoßen worden, konnte sich auf politische Basisbewegungen aber nicht ausreichend stützen und lief daher in regionale und fraktionelle Separationen der Staatsapparate aus, bis hin zu Abspaltungen und Austritten ganzer Teilstaaten aus der Union. Auch diese Vorgänge waren Überwindung des Stalinismus, jedoch in ganz anderer politischer Gestalt als in Osteuropa.
In dieser zerklüfteten Landschaft leben wir seit 35 Jahren; sie erstreckt sich in Wahrheit von der Elbe bis Wladiwostok. Im europäischen Teil haben zwar Mehrheiten sich für Demokratie entschieden, doch das verspätete Bürgertum, das sie an die Macht brachten, zeigt sich recht anlehnungsbedürftig. Die politische Initiative ist längst wieder vollständig an die Staaten des Westens zurückgefallen, die aber sprechen falsch und handeln blind in Osteuropa. Sie reden unaufhörlich vom „Ende des Kalten Krieges“, das 1989/91 erreicht worden sei, obwohl sie ihn mit Ausgrenzungen aller Art und Nato-Erweiterungen doch ständig fortsetzen. Die Formel verdeckt nur ihr Siegesgeschrei, sie wollen damit sagen, sie hätten jenen Krieg gewonnen und dürften nun nicht aufhören, weiterhin zu siegen.
Tatsächlich sind sie inzwischen dabei, aus den Ergebnissen der „friedlichen“ Revolutionen besser „kriegstüchtige“ Gesellschaften zu formen. Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, ein besonderer Fall, weil es die beiden sozialen Erfahrungen – osteuropäische und westliche Sozialisation –, aus denen die gegenwärtige weltpolitische Lage zusammengesetzt ist, in ziemlich reiner Form und genauer territorialer Verteilung aufweist. Bei zwei Gesellschaften im Bauch eines Staatsschiffes erzeugt schon eine allein Ungleichgewicht und Schlagseite, wenn sie nicht beachtet wird. So waren es ostdeutsche Erfahrungen, die 2015 mit Neuausrichtung der Partei und Mitgliederbasis Ost die entscheidende Geburtshilfe für die heutige AfD leisteten.
Vielleicht liegt in Deutschland sogar der Schlüssel der europäischen Situation. Nicht etwa, weil die merkwürdige AfD so stark, die Linke so verwirrt und die Demokraten so müde wären, sondern weil die politischen Inhalte, die 1989 die neue Zeit eröffneten, bei uns gleichzeitig vorhanden und unsichtbar sind, im gleichen Schritt schwerwiegend, aber nur unöffentlich auftreten. Sie wirken also im öffentlichen Bewusstsein und im institutionellen Mechanismus der Republik lediglich als Bremse und Verzerrung, finden auch nach drei Jahrzehnten Bundesrepublik in deren politischen System keine Adresse und keine Vertretung. In dieser kalten Reinheit trifft das nur für Deutschland zu; es ist, als ob das alte Westdeutschland nur einmal das Portemonnaie umgedreht und ausgeschüttet habe, um über die vielen Jahre hinwegzukommen, ohne die Gesellschaft verändern zu müssen.
Es ist zuletzt doch öfter erzählt worden, wie Anfang der 90er die befreiten ostdeutschen Medien zerstört wurden, um die Deutungshoheit des Geschehens an den Geist der alten Bundesrepublik zu binden, aber verstanden wird es bis zum heutigen Tag nicht. Mit der Vernichtung der selbstgeschaffenen und selbstbestimmten Öffentlichkeit blockierte man den demokratischen Diskurs, verfälschte die Erfahrung der Ostdeutschen bis zur Unkenntlichkeit. Kein Ostdeutscher verachtete je die Demokratie, doch nun wurden ihm in deren Namen verstörende Abziehbilder seines eigenen Lebens gezeigt – er wandte sich also ab, machte sich seinen eigenen Reim.
Alleingelassen mit der Erinnerung, Erfahrung und den jeweiligen Lebensentwürfen fielen die Rückblicke ebenso wie die Vorblicke nicht nur zurück hinter die Perspektiven von 1989, sondern zerfielen in zwei Extreme. Kurz gesagt, hielt sich die linke Hälfte der Bevölkerung an die empirischen Einzelheiten, an die sozialen Bestandsstücke des Lebens in der DDR, das sie ja selbst mit aufgebaut hatten und daher gut kannten. Für die konservative Hälfte dagegen wurde die Erinnerung zu einem schwarzen Loch, das jeden Lichtstrahl einer gelebten Perspektive durch seine Schwerkraft verschluckte. Wenn nicht gar die frühere Angst vor Unterdrückung jetzt als Widerstand ausgegeben wurde, so löschte sie doch jede Konkretheit der Erinnerung aus. Während die eine Hälfte sich am Einzelnen festhält, sieht die andere nur noch schwarz. Unvereinbare, unbewegliche, steinerne Gegensätze; zugleich Diagnose des Gesundheitszustands des öffentlichen Bewusstseins in einem Drittel Deutschlands – seit die Gesprächsführung bei den anderen zwei Dritteln liegt.
Es ist eine erstaunlich flache Vorstellung, ein ganzes Land nicht als gewachsene Gesellschaft, sondern als eine an der Bushaltestelle wartende Menge von Einzelpersonen, die abgeholt werden möchten, aufzufassen. Und, ehrlich gesagt oder gefragt, hatten wir solche Oberflächlichkeit dem Westen überhaupt zugetraut? Steckte nicht immer ein Fünkchen Bewunderung in dem Blick über die Grenze? Wie dumm Kapitalismus macht, das verstehe ich erst, seitdem ich darin leben muss, und auch jetzt nur nach und nach. In der einen oder anderen Weise, in tausend verschiedenen Varianten und mit ebenso verschiedenen Schlussfolgerungen, ist das die Erfahrung, die jeden Ostdeutschen beschäftigt. Im Zuge dieser Arbeit werden die Bestände neu sortiert.
Noch ist nichts entschieden, weil nichts bewusst ist. Deutschlands zwei Teile leben beide vor sich hin, „schlecht und recht“, wie man sagt, genervt oder gelangweilt, überall unruhig und nervös. Es sind noch immer zwei Gesellschaften, wenn auch von einem Staat verwaltet. Da tritt das altüberlieferte Problem von Deutschlands europäischer Mittellage wieder hervor. Sie hat jetzt über die geographische und militärische Bedeutung hinaus eine soziale Dimension angenommen. Ost- und Westeuropa begegnen sich mit allen Unterschieden und Gegensätzen der Sozialisation des vergangenen Jahrhunderts in unserm Land. Soziale Gleichheit und Sicherheit treffen auf technologische Effektivität und soziale Rationalisierung.
Die polnischen Oppositionellen wussten lange vor 1989, dass der Schlüssel für grundlegende europäische Veränderungen in Deutschland liegt, sie meinten damals nur die politische Dimension, die Kräfteverhältnisse der osteuropäischen Länder gegenüber der Sowjetunion. Inzwischen könnte sich die deutsche Frage in neuer Form stellen. Nicht mehr geopolitisch, sondern für die soziale Vermittlung der mehrheitlichen Lebensansprüche. Dass hier aber Perspektiven ebenso wie Probleme überhaupt bestehen, das wissen oder spüren bislang wohl nur die Ostdeutschen.
Klaus Wolfram studierte Philosophie und Ökonomie in Ost-Berlin. Er war Mitglied im Verfassungsausschuss des Zentralen Runden Tisches, in dem ein Verfassungsentwurf für die DDR erarbeitet wurde. Klaus Wolfram war Koordinator der Programmgruppe des Neuen Forum und Mitglied im Arbeitsausschuß des NF. 1990-1992 war er Herausgeber der Wochenzeitung „Die Andere“ und Mitbegründer des BasisDruck Verlages.
Aus telegraph #143/144_2024/2025